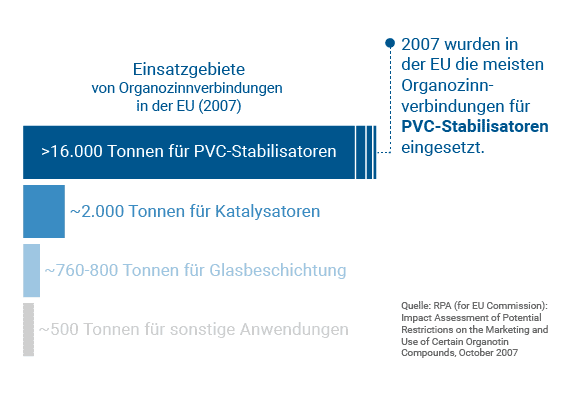Was charakterisiert einzelne Innenraum-Schadstoffe? Welche Schadstoff-Quellen gibt es? Wie wirken sich die Chemikalien auf Mensch und Umwelt aus? Und wie beurteilt das eco-INSTITUT die Stoffe? Diese und weitere Fragen klären wir in unserer Rubrik „Schadstoff-Steckbrief“.
Organozinnverbindungen (auch: Zinnorganische Verbindungen) sind synthetisch hergestellte Stoffe, die v. a. als Hilfsstoffe bei der Produktion von Kunststoffen aus Polyvinylchlorid (PVC) zum Einsatz kommen.
Charakteristisch ist die Bindung des Zinns an eine oder mehrere Kohlenstoffketten (Alkyl- oder Arylketten) sowie an weitere (an-)organische Moleküle. Anhand der Anzahl der Kohlenstoffketten unterscheidet man:
- Mono-Organozinnverbindungen
- Di-Organozinnverbindungen
- Tri-Organozinnverbindungen
- Tetra-Organozinnverbindungen
Die Kohlenstoffketten und (an-)organischen Moleküle haben einen entscheidenden Einfluss auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften und damit die Einsatzgebiete der verschiedenen Organozinnverbindungen.
Ein Großteil der Organozinnverbindungen kommt als Stabilisator in PVC-Kunststoffen zum Einsatz, insbesondere für Hart-PVC. Die Chemikalien sorgen für die Hitze- und UV-Beständigkeit des Kunststoffs.
Organozinnverbindungen werden außerdem als Katalysatoren verwendet (z. B. bei der Herstellung von Polyurethanschäumen) und in der Glasveredelung.
Auch in Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff sind Organozinnverbindungen zu finden: Bestimmte Octyl- und Methylzinnverbindungen sind hier als Stabilisatoren zugelassen.
Tetraorganozinnverbindungen dienen ausschließlich als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Mono-, Di- und Tri-Organozinnverbindungen.
Mittlerweile verbotene Einsatzgebiete:
- Weltweit: Tri-Organozinnverbindungen als sogenannte Antifoulingfarben für Schiffsrümpfe (zur Verhinderung von Bewuchs mit Algen oder anderen Meeresorganismen)
- EU-weit: Organozinnverbindungen als Biozid (z. B. in Holzschutzmitteln, Textilien, Desinfektionsmitteln)
Organozinnverbindungen gelangen sowohl bei der Herstellung als auch beim Gebrauch von Produkten in die Umwelt. So lassen sich beispielsweise Tri-Organozinnverbindungen mittlerweile in nahezu allen Fischarten nachweisen.
Anzahl und Verhältnis der Kohlenstoffketten, die an das Zinn gebundenen sind, beeinflussen stark die biologische Wirkung auf Mensch und Umwelt. Unter den Organozinnverbindungen besitzen die Tri-Organozinnverbindungen die höchste Toxizität, weniger giftig sind Di- und Tetra-Organozinnverbindungen (letztere sind chemisch sehr stabil). Mono-Organozinnverbindungen weisen die geringste Toxizität auf. Allerding enthalten Mono- und Di-organozinnverbindungen Anteile von Tri-Organozinnverbindungen als technische Verunreinigung.
Der Mensch nimmt Organozinnverbindungen insbesondere über die Nahrung auf (z. B. beim Verzehr von Fischen und anderen Meerestieren), aber auch über PVC-Kunststoffprodukte wie Handschuhe, bedruckte Textilien, Tapeten oder Bodenbeläge. Ein weiterer Aufnahmeweg – insbesondere für Kleinkinder – ist der Hausstaub.
Wirkungen auf Mensch und Umwelt
Organozinnverbindungen sind hochgiftig, verbleiben lange in der Umwelt und reichern sich in (Meeres-)Organismen an. Insbesondere
- Di-Butylzinnverbindungen (DBT),
- Tri-Butylzinnverbindungen (TBT) und
- Tri-Phenylzinnverbindungen (TPT)
wirken hochgradig auf das Hormonsystem und stören die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier. Di- und Tri-Organozinnverbindungen schädigen zudem das Immunsystem.
Stoffeinstufungen
Als fortpflanzungsgefährdend sind eingestuft:
- Di-Butylzinnverbindungen (DBT) (Dibutylzinndichlorid [DBTC] und Dibutylzinnhydrogenborat)
- Tri-Butylzinnverbindungen (TBT)
- Triphenylzinnverbindungen (TPT) (Triphenylzinnacetat, Triphenylzinnhydroxid)
DBTC und TBTO (Bis[tributylzinn]oxid) finden sich auf der REACH -Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC = substances of very high concern).
Alle Butylzinnverbindungen stehen im Verdacht, krebserzeugend zu sein.
Einige Di-Butylzinnverbindungen (DBTC und Dibutylzinnhydrogenborat), Tri-Butylzinnverbindungen und Tri-Phenylzinnverbindungen gelten als sehr giftig für Wasserorganismen.

Verbote und Einsatzbeschränkungen
Seit 2003 ist der Einsatz von Organozinnverbindungen als Antifoulingmittel in Schiffsanstrichen weltweit verboten1.
Daneben dürfen Tri-Organozinnverbindungen seit 1.7.2010 EU-weit nicht mehr in Erzeugnissen verwendet werden, wenn die Zinn-Konzentration 0,1 Gewichts-% übersteigt2.
Di-Butylzinnverbindungen sowie Di-Octylzinnverbindungen sind seit 1.1.2012 EU-weit in Gemischen und Erzeugnissen verboten, die für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind (die Zinn-Konzentration darf nicht mehr als 0,1 Gewichts-% betragen)2.
Für Organozinnverbindungen in Kunststoffen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gelten EU-weit bestimmte Migrations-Grenzwerte3.
In der EU-Biozidverordnung4 sind Organozinnverbindungen nicht mehr als Wirkstoff gelistet.
- AFS-Übereinkommen, Verordnung (EG) Nr. 782/2003
- EU-Chemikalienverordnung REACH
- Richtlinie 2002/72/EG
- Verordnung (EU) Nr. 528/2012
Das eco-INSTITUT-Label erlaubt in zertifizierten Produkten keinen Einsatz von Organozinnverbindungen.
Grenzwerte
Im Rahmen der Laborprüfung werden die Produkte auf folgende Organozinnverbindungen geprüft:
- Mono-Butylzinnverbindungen (MBT),
- Mono-Octylzinnverbindungen (MOT),
- Di-Butylzinnverbindungen (DBT),
- Di-Octylzinnverbindungen (DOT),
- Tri-Butylzinnverbindungen (TBT),
- Tri-Phenylzinnverbindungen (TPT) und
- Tricyclohexylzinnderivate (TcyT).
Der Grenzwert beträgt 0,05 mg/kg je Einzelsubstanz.
Organozinnverbindungen in verbrauchernahen Produkten: Stellungnahme des Bundesamtes für Risikoforschung (BfR) (PDF-Datei)
http://www.bfr.bund.de/cm/343
/organozinnverbindungen_in_verbrauchernahen_produkten.pdf
TBT – Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme: Texte des Umweltbundesamtes (UBA) (PDF-Datei)
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2245.pdf
Maßnahmen zur Verminderung des Eintrages von Mikroschadstoffen in die Gewässer: Texte des UBA (PDF-Datei)
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/
texte_85_2014_massnahmen_zur_verminderung_des_eintrages_von_mikroschadstoffen_in_die_gewaesser_0.pdf
Impact Assessment of Potential Restrictions on the Marketing and Use of Certain Organotin Compounds: Endbericht für die Europäische Kommission (Englisch) (PDF-Datei)
http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/07/organotins.pdf
Grafiken: Karin Roth
Alle Schlagwörter zu dem Beitrag: Schadstoff-Steckbrief, Organozinnverbindungen, eco-INSTITUT-Label